WOC GradNet
Das WOC Graduiertennetzwerk (WOC GradNet) ist Ideenwerkstatt und Ort des Austauschs für Early Career Scholars, die in verschiedenen geistes-, kultur-, sozial- und bildungswissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbereichen zu widerspruchsaffinen Themen (inklusive Widersprechen, Widerstand und widerspruchsähnlichen Formen wie Paradoxie, Unvereinbarkeit, Antinomie usw.) forschen. Dabei richtet es sich vor allem an Doktorand*innen, die Interesse und Spaß daran haben, an selbstorganisierten Workshops, gemeinsamen Kolloquien und kreativen Formaten der Wissensproduktion und -vermittlung mitzuarbeiten. Ziel ist es, das interdisziplinäre Miteinander, Peer Mentoring und die interdisziplinär strukturierte Vernetzung und Einbettung von Forschungsvorhaben zu unterstützen. Darüber hinaus übernimmt das GradNet mit zwei gewählten Sprecher*innen institutionelle Verantwortung in WOC.
Angenommene Doktorand*innen und Postdoktorand*innen, die zu widerspruchsaffinen Themen forschen, können einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Ebenso können Studierende der Universität Bremen sowie Doktorand*innen und Postdoktorand*innen anderer Universitäten einen Antrag auf assoziierte Mitgliedschaft stellen und in die Aktivitäten des WOC GradNets eingebunden werden. Für Fragen und weitere Informationen kontaktieren Sie den GradNet Koordinator Jonas Trochemowitz.
The WOC Graduate Network (GradNet) is a place for exchanging Ideas and knowledge between Early Career Scholars. We are doctoral candidates doing research in the fields of Anthropology, Linguistics, Literary Criticism, Law, Media Didactics and Political as well as Religious Studies. Phenomena like paradoxes, acts of oppositions and dissent are topics we are interested in. The WOC GradNet aims to attract doctoral candidates who have fun in self-organized workshops and creative formats of knowledge production. Our goal is to foster interdisciplinary cooperation and facilitate networking. Furthermore, the WOC GradNet takes institutional responsibility by annually electing two spokespeople for the WOC Rat.
Doctoral Candidates accepted by the doctoral committee of the University of Bremen can apply for a membership. Additionally, doctoral candidates of other universities and students who are interested in the study of contradiction can apply for associated membership. For further questions contact the WOC GradNet Coordinator Jonas Trochemowitz.
Mitglieder
Jan Schulze Buschoff (Fachbereich 08)

Politikwissenschaft
Promotionsprojekt
Die ehemals unter Front National bekannte rechtsaußen Partei Frankreichs, seit 2018 umbenannt in Rassemblement National, hat seit dem Wechsel der Parteispitze 2011 einen Wandel vollzogen, der zumindest nach außen hin bürgerlich erscheint. Doch trotz ihrer Entteufelungsstrategie, angestrengt durch die neue Vorsitzende Marine Le Pen, bleibt die Partei innerhalb rechtsextremer Strukturen verhaftet. Es drängt sich sogleich die Frage auf, wie eine Partei demokratische Prinzipien predigen kann, mit gleichbleibender fremdenfeindlicher Grundgesinnung. Der unverblümte Widerspruch, bestehend zwischen republikanischem Handeln und nationalistischem Denken, macht eine genauere Untersuchung des RN notwendig, auch um potentiell subversive demokratiegefährdende Ambitionen zu erkennen. Das Ziel meines Projektes ist es herauszufinden, mit welchen Kommunikationsstrategien die Partei arbeitet, um sich ihres rechtsextremen Erscheinungsbildes zu entledigen. Dazu bediene ich mich der Hegemonietheorie von Laclau und Mouffe, um mittels einer Diskursanalyse die Vorgehensweise des RN sichtbar zu machen.
Julia Gelhaar (Fachbereich 06)

Sprecherin GradNet
Rechtswissenschaft
Promotionsprojekt
Mein Forschungsprojekt trägt den Arbeitstitel „Das Konzept des internen Schutzes in Anwendung auf afghanische Geflüchtete − Deutschland, Österreich und die Niederlande im Rechtsvergleich“. Dieses von mir untersuchte Rechtskonzept bewegt sich in einem starken Widerspruch: Es gibt klar definierte menschenrechtliche Grenzen, einen europäischen und internationalrechtlichen Rahmen – dennoch bleiben diese von den Fachgerichten häufig unbeachtet. Hier tangiert das Recht die Politik, was beispielhaft verdeutlicht, wie gerade das Migrationsrecht vom interdisziplinären Austausch lebt.
Publikationen
Regenbogenflagge als „Fußabtreter“ – Das Verwaltungsgericht Weimar legitimiert rechten Hass auf LGBTQIA+, in: Austermann et al. (Hrsg.), Recht gegen rechts Report 2023, Frankfurt a. M. 2023, S. 253 ff.
Christlicher Nächstenhass – Der Fall Latzel und das Kulturprivileg des fundamentalistischen Christentums (mit Norina Köslich und Tore Vetter), in: Kritische Justiz 2/2022, S. 207–218.
Im Namen der Neutralitätspflicht – Brandenburg entlässt Lehrer mit rechten Tattoos, in: Austermann et al. (Hrsg.), Recht gegen rechts Report 2022, Frankfurt a. M. 2022, S. 77–83.
Mit Sicherheit gegen Migration, Verfassungsblog, 15.11.2021, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/os2-mit-sicherheit/
The countering of migration with security, Verfassungsblog, 15.11.2021, available at: https://verfassungsblog.de/os2-migration-security/
Rubrik: Rechte Ab-Gründe, in: Kritische Justiz 3/2021, S. 377–381.
Hitlergruß im Klassenzimmer – Staatsanwaltschaft Halle sieht keinen Grund zum Handeln, in: Austermann et al. (Hrsg.), Recht gegen rechts: Report 2020, Frankfurt a. M. 2020, S. 199–205.
Rubrik: Rechte Ab-Gründe (mit Anika Grotjohann, Andreas Gutmann und Fatou Sillah), in: Kritische Justiz 3/2020, S. 387–392.
Wird der Bremer Polizei nun auf die Finger geschaut? Anmerkungen zum Bremer Polizeigesetz (Teil 2) (mit Catharina Pia Conrad, Andreas Gutmann, Gianna M. Schlichte und Tore Vetter), Verfassungsblog, 16.7.2020, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/wird-der-bremer-polizei-nun-auf-die-finger-geschaut/
Gegen den Verschärfungsstrom? Anmerkungen zum Bremer Polizeigesetz (Teil 1) (mit Catharina Pia Conrad, Andreas Gutmann, Gianna M. Schlichte und Tore Vetter), Verfassungsblog, 14.7.2020, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/gegen-den-verschaerfungsstrom/
Rubrik: Rechte Ab-Gründe (mit Florian Nustede), in: Kritische Justiz 2/2020, S. 270–274.
Der ‚unangepasste‘ Prof. Dr. Zaun24 (mit Andreas Fischer-Lescano), in: myops 39/2020, S. 20–25.
Rubrik: Rechte Ab-Gründe (mit Nele Austermann, Andreas Fischer-Lescano, Tore Vetter), in: Kritische Justiz 1/2020, S. 114–134.
Gutachten im Auftrag der Linksfraktionen von Berlin und Hamburg: Soziale Rechte für Menschen ohne Papiere – Zulässigkeit der Einführung einer city-ID in Stadt-Staaten (zusammen mit Helene Heuser, Nele Austermann), Januar 2020, abrufbar unter: https://www.jura.uni-hamburg.de/lehrprojekte/law-clinics/refugee-law-clinic/forschungsprojekt-staedte-der-zuflucht/rechtsgutachten-cityid.pdf
Interner Schutz? – Das Konzept in der deutschen Rechtsprechung in Anwendung auf afghanische Geflüchtete, in: Kritische Justiz 2/2019, S. 176–192.
Die Praxis der Alterseinschätzung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, in: Kritische Justiz 2/2018, S. 179–192.
Rosa Luetge (Fachbereich 09)
Antonia Kempkens (Fachbereich 09)

Philosophie
PROMOTIONSPROJEKT
Der Titel meiner Doktorarbeit lautet: „Elemente eines öffentlichen Datenökosystems – welche ethischen Leitlinien sind zu beachten?“. Mein Forschungsthema beschäftigt sich also mit Datenhandel und dessen ethischen Gefahren. Der größte Widerspruch besteht dabei zwischen der für ein Datenökosystem notwendigen Datenverarbeitung und der dadurch gefährdeten Privatsphäre von Datenquellen (wenn es sich um personenbezogene Daten handelt). Ein weiterer Widerspruch besteht zwischen algorithmischer Datenverarbeitung, die neues Wissen generieren soll, dabei aber nicht transparent ist. Wissen kann nur dann so bezeichnet werden, wenn erklärbar ist, wie dieses entstanden ist. Ohne Bewusstsein für den Widerspruch zwischen Datenverarbeitung und Privatsphäre bzw. Transparenz, wird in dem Design neuer Datenökosysteme keine Rücksicht darauf genommen und es wird kein Versuch unternommen den Widerspruch aufzulösen. Mein Ziel ist es, einen Weg zu finden von der Datenverarbeitung in Datenökosystemen zu profitieren und gleichzeitig die Privatsphäre von Datenquellen zu schützen sowie Transparenz zu ermöglichen, sodass der ursprüngliche Wiederspruch zu einem verbesserten technischen Design von Datenökosystemen führt.
Katharina Nowak (Fachbereich 09)

Sprecherin GradNet
Sozial- und Kulturanthropologie, Museologie
Promotionsprojekt
Arbeitstitel: Dekoloniale Wissensproduktion ethnographischer Sammlungen. Museen neu denken.
Im Rahmen meines Promotionsprojekts möchte ich museale Sammlungen, die vor oder während der Kolonialzeit aus Gebieten der damaligen (deutschen) Kolonien im heutigen Pazifik (Ozeanien) nach Deutschland kamen, untersuchen. Meine Forschungsvorhaben zielt auf eine Sichtbarmachung unterschiedlicher epistemischer Praktiken ab und fragt exemplarisch, inwiefern diese verschiedenen Praktiken miteinander in häufig durch Macht und asymmetrische Wissensordnungen geprägten Beziehungen stehen und wie die differenten Praktiken und ihre Artikulation in Ausstellungsprojekten und in der Museumsarbeit innovativ und symmetrisch angemessen repräsentiert werden können. Ziel meiner Forschung ist es, anhand von einzelenen Objekten der musealen und ethnologischen Sammlungen des Linden-Museums Stuttgarts, eine vielstimmige und multiperspektivische Darstellung der Objektzirkulation, unter anderem auch im Hinblick auf das Wissen der Bevölkerung der pazifischen Inselstaaten über Europäer:innen, zu rekonstruieren. Dabei soll der Wissenstransfer vergleichend von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft betrachtet werden. Die Fragestellung wird in Hinblick auf die These untersucht, dass museale Sammlungen als Wissensspeicher Einfluss auf das produzierte Wissen nehmen, untersucht.
Ich forsche im Promotionsverbund „A Doctorate in the Museum – the Local and Global Dimensions of Objects in Anthropological Museums in Baden-Württemberg Today“ (DIMA) der Universität Tübingen und des Linden-Museum Stuttgart.
Publikationen
Nowak, K. 2023: Colonial Entanglement, “South Sea” Imaginations and Knowledge Production. In: Andratschke, C., Müller, L., & Lembke, K. (eds.): Provenance Research on Collections from Colonial Contexts: Principles, Approaches, Challenges. arthistoricum.net-ART-Books, p. 180-191.
https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1270
Nowak, K. 2023: Postkoloniale Sammlungsforschung. Zur Dekolonisation von ethnographischen Sammlungen durch kollaborative Wissensproduktion. In: Junges Forum für Sammlungs- und Objektforschung – Band VII. Herausgegeben von der Gesellschaft für Universitätssammlungen e.V., p. 43-52.
Nowak, K. 2023: The Water Think Tank. In: Palaić, T., Buchczyk, M., & Joyce, A. (eds.): TRACTS COST. Action’s Practicing Collection Ethics toolkit, p. 22-23.
https://tractsnetwork.online/2023/11/17/practicing-collection-ethics-toolkit/
Nowak, K. 2023: Climate Crisis – the Decline of Biodiversity and an Over 140-Year-Old Necklace. In: Spaces of Care – Confronting Colonial Afterlives. In: Modest, W., & Augustat, C. (eds.): European Ethnographic Museums. Bielefeld: transcript Verlag, p. 153-157.
Nowak, K. & Wild, J. (Hg.) 2023: Wasser Botschaften. Water Messages. Zweisprachiger Katalog zur gleichnamigen Ausstellung. Hamburg: Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt.
Bartels, H., Burda, T., Eggart, C., Nowak, K., & Wiederkehr, S. 2022: „Can you hear me?“ Five reflections about ‚building rapport‘ online in times of a Pandemic. Journal of Social & Cultural Anthropology / Zeitschrift für Ethnologie (ZfE), 2022, Vol 147, Issue 1, p. 13-32.
Grimme, G., & Nowak, K. 2022: The Emergence of New Contact Zones? Ethnographic Museums, Corona and the Digital Age. In: Journal of Social & Cultural Anthropology / Zeitschrift für Ethnologie (ZfE), 2022, Vol 147, Issue 1, p. 33-51.
Nowak, K. 2020: Digitale und digitalisierte Daten und die Rekonstruktion von Wissen.Beitrag zur Herbstakademie „Fieldwork meets Crisis“ der DGSKA.
https://boasblogs.org/fieldworkmeetscrisis/digitale-und-digitalisierte-daten-und-die-rekonstruktion-von-wissen/
Nowak, K. 2019: The American Dream – Nur ein Traum? Repräsentation des ‚Anderen‘ in der Ausstellung „Amerika“ des Übersee-Museums in Bremen. In: Studien zur Materiellen Kultur. Band 32. Oldenburg: Institut für Materielle Kultur, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Achterberg R., et al. (2018): Zwischen zwei Welten. Menschen mit und ohne Behinderungen erzählen. In: Studien zur Materiellen Kultur. Band 28. Oldenburg: Institut für Materielle Kultur, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Jendrik Nuske (Fachbereich 08)

Politische Theorie
Promotionsprojekt
Mit meinem politiktheoretischen Projekt will ich untersuchen, wie kollektives Handeln jenseits des Versprechens individueller Selbsterhaltung und Bedürfnisbefridigung motiviert wird. Besonders interessant ist dabei, dass religiöse und metaphysische Weltbilder in dieser Hinsicht effektiver scheinen, als sogenanntes postmetaphysisches Denken. Um diesen Unterschied zu erklären, werden psychologische Werke hinzugezogen, welche die Zuschreibung von und Suche nach Bedeutung als motivationale Faktoren individuellen Handelns behandeln. Ein Fokus wird dabei der Vermittlung bzw. Steuerung gelten, welche intersubjektive Kommunikation zwischen individueller Bedeutungssuche und kollektiver Bedeutungszuschreibung vollzieht. So soll insbesondere auch erklärt werden, wie Widersprüche – sowohl zwischen Individuen in Kollektiven, als auch in ihrem Räsonieren – per Bedeutung überbrückt werden.
My politological-theoretical project seeks to explore how collective action is motivated beyond the promise of individual self-preservation and need satisfaction. It is especially remarkable, that metaphysical worldviews seem more effective in this respect than so-called postmetaphysical thought. To explain this difference, psychological works regarding the ascription of and search for meaning as motivational factors of individual action are included. Close attention will be given to the mediation and control facilitated by intersubjective communication between individual searches for and collective ascription of meaning. Accordingly, the project is also particularly interested in how contradictions – both between individuals in collectives, and within their reasoning – are bypassed via meaning.
PUBLIKATIONEN
Hilgerloh, Jendrik (2017): Antispeziesismus in der Diskursethik. Wie wäre ein nach Habermas gültiger Diskurs zu Tierethik angelegt? Bremen: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00106208-15
Hilgerloh-Nuske, Jendrik (2020): Die Kolonialisierung des Internets. Habermas‘ System-Lebenswelt Gegensatz in der digitalen Öffentlichkeit. Bremen: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. DOI: https://doi.org/10.26092/elib/169.
Hagen Steinhauer (Fachbereich 10)

Germanistische Sprachwissenschaft / Interdisziplinäre Linguistik
Promotionsprojekt
Ich bin seit 2019 Mitglieder der Forschungsgruppe „Soft Authoritarianisms“, in welcher wir unter der Leitung von U Bremen Excellence Chair Shalini Randeria einem zunächst paradox erscheinenden aber global immer häufiger auftretenden Phänomen nachgehen: Der Aushöhlung der Demokratie mit demokratischen Mitteln. Unser Begriff des sanften Autoritarismus betont dabei die Gleichzeitigkeit von demokratischem Verfahren und illiberalen, autoritären, national-identitären und oft rassistischen Diskursen, die zur internen Spaltung der Wählerschaft entlang ethnischer, religiöser und ideologischer Linien genutzt werden. Die resultierende Polarisierung verbunden mit anti-demokratischen aber oftmals legalen Mitteln der Minderheitendiskriminierung geht mit Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit und der diskursiven Delegitimierung von Kritik einher. Am Beispiel von Frankreich untersuche ich, wie ein solcher national-identitärer Autoritarismus mit sprachlich-diskursiven Mitteln normalisiert wird und so die Öffentlichkeit und sogar die Regierungsrhetorik und -politik prägt.
Publikationen
Beiträge in Sammelbänden:
Steinhauer, Hagen. 2020. Widerstand oder Anpassung? Widersprüchliche Bewertungen der Frankfurter Zeitung im NS-Pressediskurs. Kämper, Heidrun & Ingo H. Warnke: Diskurs ‑ethisch. Bremen: Hempen, 57–72.
Dreesen, Philipp & Hagen Steinhauer. 2018. Presseanweisungen und Resistenzakte aus diskurspragmatischer Perspektive. Die Frankfurter Zeitung im Nationalsozialismus. Kämper, Heidrun & Britt-Marie Schuster: Sprachliche Sozialgeschichte des Nationalsozialismus. Bremen: Hempen, 217–244.
Rezensionen:
Steinhauer, Hagen. 2021. Roth, Kersten Sven/Wengeler, Martin/Ziem, Alexander (eds.) (2017): Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft (Handbücher Sprachwissen 19). Berlin/Boston: De Gruyter. 611 S. Sociolinguistica 35 (1), 288–291.
Steinhauer, Hagen. 2016. Mathias, Alexa (2015): Metaphern zur Dehumanisierung von Feindbildern. Eine korpuslinguistische Untersuchung zum Sprachgebrauch in rechtsextremen Musikszenen. In: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 89, 237-241.
Tagungsberichte:
Steinhauer, Hagen & Jessica Weidenhöffer. 2017. Nachwuchssymposium des Tagungsnetzwerks Diskurs – Interdisziplinär. Zeitschrift für Diskursforschung, 5 (1), 97-105.
Jonas Trochemowitz (Fachbereich 10)

Germanistische Sprachwissenschaft
Promotionsprojekt
Als Diskurslinguist interessiere ich mich dafür, wie soziale Wirklichkeit, Macht und Positionen durch diskursive Praktiken sprachlich konstituiert werden. Im Rahmen meiner Forschung beschäftige ich mich mit gesellschaftlichen Konflikten und dem Streit um die Deutungshoheit von Widersprüchen. Wo werden Widersprüche durch welche sprachlichen Praktiken sichtbar gemacht, wo bleiben sie unsichtbar und aus welchen sozialen Positionen wird bestimmt, was im Diskurs als Widerspruch anzuerkennen ist? Mein Fokus liegt dabei auf der Analyse von Gender- und Sexualitätsdiskursen mit einem Interesse dafür, wie die Konstruktion und Dekonstruktion heteronormativen Wissens mit der Deklaration von Widersprüchen zusammenhängen.
As a linguist working in the field of discourse analysis, I am interested in how social reality, power and positions are being constituted via language. For my project I seek to explore different forms of agonalitiy and societal conflict concerning contradictions. Therefore, I am interested in how the way society talks about contradictions determines the way which forms of relations ought to be seen as contradictory. As a case study I will do research on how heteronormative knowledge is (de-)constructed within (queer)-feminist as well as antifeminist discourses about gender- and sexuality.
Publikationen
Trochemowitz, Jonas (2022): »Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache« Sprachideologische Positionierung im Diskurs der Identitären Bewegung. In Wiener Linguistische Gazette (WLG) 91 (2022): 1–36. Verfügbar unter: Link
Tore Vetter (Fachbereich 06)

Rechtswissenschaft
Promotionsprojekt
In meiner Dissertation beschäftige ich mich aus verfassungstheoretischer Sicht mit dem Versammlungsrecht und insbesondere dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Dabei interessiert mich insbesondere die demokratische Begründung der Versammlungsfreiheit an der Schnittstelle zwischen Politik und Recht. Ausgangspunkt meiner Forschung ist dabei die Frage, wie neue Versammlungsphänomene, etwa Protestcamps oder digitale Zusammenkünfte, die bisher gerichtlich nicht (stringent) als grundrechtlich geschützte Versammlungen anerkannt sind, rechtlich rezipierbar sind. Hierbei beschäftige ich mich mit dem Problem, dass die Versammlungsfreiheit als für die demokratische Gesellschaft konstitutives Grundrecht gerade dann am nötigsten ist, wenn ihre Geltungsbedingungen in Frage gestellt werden. Dies ist nicht nur etwa in autoritären Nationalstaaten der Fall, sondern auch dann, wenn Räume der Öffentlichkeit sich ins Digitale und Private verlagern. Als Grundrecht, zu widersprechen und kollektiven Dissens zu artikulieren, berührt die Versammlungsfreiheit zudem die Grundparadoxien des Rechts. Einerseits obliegt die Deutungshoheit (supra-)nationalen Institutionen, den Verfassungsgerichten, andererseits enthält die Versammlungsfreiheit prägnante kollektive Autonomieaspekte, die gerichtlich auch im Selbstbestimmungsrecht der Versammlung anerkannt sind. Ob Versammlungsphänomene über das Recht auf Selbstkonstituierung hinaus auch eigenkonstitutionelle, rechtlich rezipierbare Entwicklungen zeigen, die eine Anerkennung im Recht zeitigen, ist ein Schwerpunkt meiner Forschung.
Publikationen
Corona-Leugner marschieren – Wie Behörden und Gerichte in Kassel die Gefahr verharmlosen, in: Recht gegen Rechts: Report 2022, Fischer 2022, i.E., S. 31 ff.
Recht gegen Rechts: Report 2022, Fischer 2022 (Herausgeber, mit Austermann u.a.), i.E.
Invisibilising Nature. Procedural Limits and Possibilities to Environmental Litigation in German Law (mit Elena Ewering), VRÜ, 54 (2021) 3, S. 376 ff.
Der Querfront auf den Leim gegangen – Warum Versammlungsverbote nicht gegen die „Querdenken“-Bewegung helfen (mit Andreas Gutmann), KJ 2021, S. 85 ff.
Verquere Schuldzuweisungen: Die Versammlungsfreiheit in Sachsen nach #le0711 (mit Andreas Gutmann), Verfassungsblog, 13.11.2020, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/verquere-schuldzuweisungen/
Rassistische Beamt*innen – Und wie der Staat sie wieder loswird (mit Nils Kohlmeier), in: Recht gegen Rechts: Report 2020, Fischer 2020, S. 181 ff.
N-Wort im Landtag – Greifswalder Verfassungsgericht billigt rassistische Pöbeleien, in: Recht gegen Rechts: Report 2020, Fischer 2020, S. 165 ff.
Unheimlich unpolitisch – Warum die derzeitige Ausbildung furchtbare Jurist*innen fördert, in: Recht gegen Rechts: Report 2020, Fischer 2020, S. 63 ff.
Recht gegen Rechts: Report 2020, Fischer 2020 (Herausgeber, mit Austermann u.a.)
§ 5 VersammlG (mit Sebastian Eickenjäger und Hanna Haerkötter), § 15 VersFG SH (mit Hanna Haerkötter), § 20 VersFG SH (mit Elena Ewering) in: Ridder/Breitbach/Deiseroth u.a. (Hrsg.), Kommentar Versammlungsrecht, Nomos 2020
Wird der Bremer Polizei nun auf die Finger geschaut? Anmerkungen zum Bremer Polizeigesetz (Teil 2) (mit Catharina Pia Conrad, Julia Gelhaar, Andreas Gutmann und Gianna M. Schlichte), Verfassungsblog, 16.7.2020, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/wird-der-bremer-polizei-nun-auf-die-finger-geschaut/
Gegen den Verschärfungsstrom? Anmerkungen zum Bremer Polizeigesetz (Teil 1) (mit Catharina Pia Conrad, Julia Gelhaar, Andreas Gutmann und Gianna M. Schlichte), Verfassungsblog, 14.7.2020, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/gegen-den-verschaerfungsstrom/
Rubrik: Rechte Ab-Gründe (mit Nele Austermann, Andreas Fischer-Lescano, Julia Gelhaar), in: Kritische Justiz 1/2020, S. 114–134.
Donata Weinbach (Fachbereich 10)

Neuere deutsche Literaturwissenschaft (Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts), Literaturtheorie
Promotionsprojekt
In meinem Projekt geht es um Figur der Anthropophagie, deren kulturelle Semantiken anhand ihres sowohl realen als auch symbolischen Erscheinens in ausgewählten literarischen und anthropologischen Texten rekonstruiert werden. Die Figur transportiert auf unterschiedliche Weisen inter- und transkulturelle Erfahrungen, Fremdverstehen sowie literarische Exotismen oder ihre Dekonstruktion. Im Spannungsfeld zwischen Ethnologie und Literatur, zwischen Eigenem und Fremden, zwischen Metapher und Anti-Metapher werden die einem Verständnis von Kannibalismus inhärenten Widersprüche aufgezeigt und analysiert.
Publikationen
Schiffbruchallegorien: Sinnbilder eines Lebenszustands. In: Arnd Beise/Michael Hofmann (Hgg.) Peter Weiss Jahrbuch. Literatur, Kunst und Politik im 20. und 21. Jahrhundert, Band 30, St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 2021 (In Vorbereitung).
Die vertraute Fremdheit der Anthropophagie: Franzobels Floß der Medusa (2017). In: Wolfgang Lukas/Martin Nies (Hgg.): Das anthropologische Wissen der Literatur: Identität & Fremdheit 2021 (In Vorbereitung).
Der Hunger, zu sehen. Kannibalistische Einverleibung in Franzobels Das Floß der Medusa (2017). In: Lehnert, Nils/Meinen, Iris (Hgg.): Öffnung – Schließung – Übertritte. Körperbilder in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Bielefeld 2021, S. 225-240.
„Mich zu verlieren / Bin ich da“. Über Selbstverlust und Welterfahrung in der Moderne, Bericht zur Tagung am DFG-Graduiertenkolleg 1608 „Selbst-Bildungen. Praktiken der Subjektivierung“ vom 9.-11. Mai 2019 in H-Soz-Kult: 30.08.2019, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8416.
Jenseits von Mond und Magen. Herrndorfs Diesseits des Van-Allen- Gürtels (2007) oder eine Kannibalismus-Poetik. In: Matthias Lorenz (Hg.): „Germanistenscheiß“. Beiträge zur Werkpolitik Wolfgang Herrndorfs, Berlin 2018, S. 303-322.
Deviante Dickhäuter. Vier Geschichten vom Begehren, den Elefanten zu ’sehen‘. In: Frank Jacob, Theresia Raum (Hgg.): Mit Pauken und Trompeten. Elefanten in der Geschichte. Darmstadt 2017 (gemeinsam mit Steffen Kreißl, Lisa Margowski, Paul Luka Reinke und Alexander Wagner), S. 185-214.
Appetit auf Afrika – stereotype Bedeutungszuschreibung am Beispiel von Chakalaka und Joe’s Beerhouse. In: Kellermeier-Rehbein, Birte, Matthias Schulz und Doris Stolberg (Hg.): Sprache und (Post)Kolonialismus. Linguistische und interdisziplinäre Aspekte. Berlin/München/Boston 2018, S. 265-279.
Schenken als soziale Praxis – Perspektiven auf zeremonielle Tauschhandlungen im Kontext von Eheschließungen in Sambia. In: Kreienbaum u.a. (Hgg.) Sambia – 72 Volksgruppen bilden einen Staat. Einblicke in eine postkoloniale Gesellschaft. Leverkusen 2016, S. 35-60.
Nele Woehlert (Fachbereich 10)

Unter dem Arbeitstitel #Wisskomm – Diskurs-Dimensionen von Wissenschaftskommunikation in
digitalen und sozialen Medien beschäftige ich mich mit Kommunikaten institutioneller
Wissenschaftskommunikation (W-Kommunikate) und betrachte die Form, die Funktion und den
Kontext von W-Kommunikaten in sozialen und digitalen Medien. Der These folgend, dass Wissenschaftskommunikation mit ihren Herausforderungen grundsätzlich mit Widersprüchen konfrontiert ist, werden mit Fokus darauf exemplarisch W-Kommunikate von
institutionellen/organisationellen Projekten aus dem Land Bremen
untersucht, um aus linguistischer Perspektive und mithilfe einer ergänzenden Feldstudie dazu
beizutragen, Wege der Wissenschaftskommunikation zu beschreiben, mit Widerspruch
umzugehen. Das triangulierte Vorgehen nutzt diese Verbindungen, um die genuin linguistische
Perspektive zu öffnen und W-Kommunikate detailliert mit Blick auf den Umgang mit
Widersprüchen (im Sinne von Gegenrede ebenso wie von Zielkonflikten) zu analysieren.
Forschungsinteresse: – Pragmatik, angewandte Linguistik, Psycholinguistik
– Fokus auf Wissenschaftskommunikationsforschung
Vita: – Seit 2023 Doktorandin im Bereich Germanistik an der Universität Bremen
– Seit 2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Wissenschaftskommunikation, Nachwuchs- und Graduiertenförderung, Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien – IWT
– 2018-2020 M.A. Germanistik, Universität Bremen
– 2015-2020 Studentische Hilfskraft/Werkstudentin Wissenschaftskommunikation, Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien – IWT
– 2015-2018 B.A. Germanistik/Philosophie, Universität Bremen
GradNet Off Campus
Intersektionalität und Widerspruch #1 - Ein Gespräch mit Felicia Ewert
Am 29. Juni 2022 fand im Parkcafé des Kukoons in Bremen die erste Veranstaltung der Gesprächsreihe “GradNet Off Campus” statt. Für den Auftakt konnte die Politikwissenschaftlerin, Referentin und Aktivistin Felicia Ewert als Gesprächspartnerin gewonnen werden. Thema der Veranstaltung waren Widersprüche im Kontext transgeschlechtlicher Lebenserfahrung, Aktivismus und Wissenschaft. Ein besonderes Anliegen der Veranstalter*innen war es, das Thema aus einer machtkritischen und intersektionalen Perspektive zu betrachten.

Ein wichtiger Aspekt der Veranstaltung war die Interaktion zwischen Felicia Ewert und dem Publikum. So konnten die Teilnehmer*innen einerseits mündlich, aber auch schriftlich per Zettel oder online Fragen stellen. Dieses Angebot zur Interaktion wurde von den rund 70 Besucher*innen ausgiebig genutzt. Felicia Ewert kritisierte die Diskriminierung von transgeschlechtlichen Menschen durch das aktuelle Transsexuellen-Gesetz und legte dar, welche widersprüchlichen Erwartungen an Geschlechtlichkeit diesem zugrunde liegen.
Es wurde außerdem thematisiert, wie Universität und Lehre zu einem diskriminierungsfreien und inklusiveren Raum für Trans*-Personen werden können. Zum Beispiel können das Vorlesen von Namenslisten oder gut gemeinte Vorstellungsrunden in der ersten Seminarsitzung, in denen Menschen ihre Pronomen nennen, zu Zwangsoutings führen.
Ein weiterer Aspekt, welcher die Widersprüchlichkeit betrifft, war, dass angenommen werde, Diskriminierungserfahrung und Privilegien würden einander ausschließen. Felicia Ewert wies darauf hin, dass dies nicht der Fall sei. Aus einer intersektionalen Perspektive ergibt sich ein anderes Bild: weiße, cis-geschlechtliche Frauen erleben zwar Diskriminierung, jedoch ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass sie trotzdem Privilegien besitzen, welche zum Beispiel transgeschlechtlichen und Schwarzen Frauen nicht zustehen.

Ihr Appell lautete verschiedene Formen der Diskriminierung von Frauen kritisch zu differenzieren und im feministischen Kampf um Gleichberechtigung mitzudenken.
Organisiert wurde das Event von Verena Honkomp-Wilkens, Katharina Nowak und Jonas Trochemowitz mit Unterstützung weiterer Mitglieder des WOC Graduiertennetzwerkes und zweier studentischer Mitarbeiter.
Ehemalige
Catherine Herbin (Fachbereich 09)

Philosophie (Promotionsfach), Musikwissenschaft
Promotionsprojekt
Aktuell befasse ich mich aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive heraus mit den Grundlagen des Faches Musikwissenschaft. Im Kontext meiner entstehenden Dissertation habe ich vor allem grundlegende Begriffe und Werte ausgewählter Positionen der letzten 50 Jahre im Fokus. Der Widerspruch wird in meiner Arbeit vor allem im Zuge der Analyse diverser Musikbegriffe und zwischen wissenschaftlichen Konzeptionen relevant werden. Ebenso thematisiere ich den Widerspruch bzw. die Relevanz von Widerspruchsfreiheit in konkreten wissenschaftlichen Wertesystemen selbst. Letztlich wird auch zentral werden, inwiefern die Vereinbarkeit oder Nicht-Vereinbarkeit von Begriffen überhaupt maßgeblich für die Ausgestaltung dieser Fachdisziplin ist.
Verena Honkomp-Wilkens (Fachbereich 12)

Medienpädagogik und Didaktik multimedialer Lernumgebungen
Promotionsprojekt
In meiner Forschung möchte ich mich mit der Performativität von Gender/Geschlechtsidentität im digitalen informellen Lern- und Bildungsraum beschäftigen. Wichtig ist es mir dabei, eine intersektionale Perspektive einzunehmen und auch die Potentiale des digitalen Raumes für einen niedrigschwelligen Zugang zu Wissen, Informationen und Bildung zu untersuchen. Meine Fragen lauten zum Beispiel: Welche Widersprüche prägen die Repräsentation von Geschlecht im informellen digitalen Lern- und Bildungsraum? Inwiefern können diese Widersprüche zur Dekonstruktion von bestehenden Geschlechterstereotypen beitragen?
Christian Leonhardt (Fachbereich 08)

Politische Theorie
Promotionsprojekt
Publikationen
Zieringer, Carolin; Leonhardt, Christian, 2020: Politik, Körper, Ironie: Rancière queer-feministisch weiterdenken, in: Mareike Gebhardt (Hg.), Staatskritik und Radikaldemokratie. Das Denken Jacques Rancières, Staatsverständnisse, Baden-Baden: Nomos, S. 171 – 187
Leonhardt, Christian, 2019: Jenseits der guten Ordnung. Theoretische Konstellationen zwischen Bakunin, Rancière und CrimethInc., in: Mathis, Klaus/Langensand, Luca (Hg.), Anarchie als herrschaftslose Ordnung?, Berlin: Duncker & Humblot, S. 95 – 119
Leonhardt, Christian, 2019: Henry David Thoreau, in: Comtesse, Dagmar/Flügel-Martinsen, Oliver/Martinsen, Franziska/Nonhoff, Martin (Hg.), Handbuch Radikale Demokratietheorie, Berlin: Suhrkamp, S. 115 – 120
Leonhardt, Christian; Nonhoff, Martin, 2019: Widerständige Differenz. Transnationale soziale Bewegungen zwischen gegenhegemonialer Institutionalisierung und nicht-integrativer Präfiguration, in: Zeitschrift für Politische Theorie, 10 (1), S. 9 – 28
Leonhardt, Christian, 2018: Reinszenierungen. Von der Szene der Plebejer zur Untersuchung des politischen Moments in gegenwärtigen Bewegungen, in: Linpinsel, Thomas/ Lim, Il-Tschung (Hg.), Jacques Rancière und die Sozialwissenschaften, Wiesbaden: Springer, S. 141 – 163
Leonhardt, Christian, 2017: Zwei Namen des Ausnahmezustandes. Giorgio Agamben und Jacques Rancière im Unvernehmen, in: Matthias Lemke (Hg.), Ausnahmezustand. Theoriegeschichte – Anwendungen – Perspektiven, Wiesbaden: Springer VS, S. 41 – 56, Link (Stand: 04.05.2017)
Leonhardt, Christian, 2017; Reviewed: Gabriel Hürlimann; 2015, Analytik der Revolte. Über agonistische Konstellationen von Macht, Freiheit und Subjekt im Anschluss an Michel Foucault., in: Zeitschrift für philosophische Literatur, 5 (1), S. 19 – 28, Link (Stand: 06.04.2018)
Yingrui Bi (Fachbereich 10)
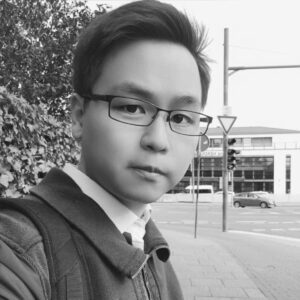
Germanistische Sprachwissenschaft
Promotionsprojekt
In meinem linguistischen Promotionsprojekt wurden sog. China-Repräsentationen im deutschen öffentlichen Raum untersucht. Unter China-Repräsentationen verstehe ich epigrammatische Aufschriften, die sich in öffentlichen urbanen Räumen in Deutschland finden und China thematisieren bzw. auf China verweisen, wozu sowohl chinesische Schriftzeichen als auch damit verbundene multilinguale und multiformale Kommunikate der Semiotic Landscape gehören. Mir ist als Chinese aufgefallen, dass viele Arten der Verwendung entsprechender Daten in Deutschland nicht in China existieren bzw. andere Bedeutungen haben als in China, womit Widersprüche/Paradoxa erkennbar werden. Im Projekt wurden zunächst China-Repräsentationen in der deutschen Semiotic Landscape induktiv im Sinne der Grounded-Theory-Methodologie gesammelt und codiert. Danach wurden diese diskurslinguistisch analysiert, sodass die Funktion/Dynamik der China-Repräsentationen aufgedeckt wurden, vor allem unter dem Aspekt von Diskursmacht.
Publikationen
Bi, Yingrui (2023): China-Repräsentationen in der deutschen Semiotic Landscape. Eine diskursorientierte Untersuchung. Berlin et al: Peter Lang.
Bi, Yingrui (2021): Die Hong-Kong Bar im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Hamburg. Online unter: https://www.re-mapping.eu/de/erinnerungsorte/hong-kong-bar.
Bi, Yingrui (2016): Bubble Tea in den Grenzen des Diskurses: Wie ein massenmedialer Bericht die Präsenz von Bubble-Tea-Läden in Deutschland beeinflusst. Bremen. Online unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00107854-13
Rezension: Bi, Yingrui (in print): Christine Römer: Streit um Wörter. Sprachwandel zwischen Sprachbeschreibung und Sprachkritik. In: Muttersprache. Vierteljahresschrift zur deutschen Sprache.
Rezension: Bi, Yingrui (in print): Niklas Gutjahr: Medial vermittelte und sprachlich ausgehandelte Nähe und Distanz. Eine interdisziplinäre Untersuchung digitaler Kommunikationsvorgänge. In: Muttersprache. Vierteljahresschrift zur deutschen Sprache.
Vorträge
IACPL 2021 30.06.2021 U Western Cape/ZAF
»Bodies under Control – On the Semiotic Transgression of German Party Tourists in the Neocolonial Apparatus« (mit Ingo. H. Warnke)
Bildungsmesse der Universität Bremen 09.11.2016
»Deutsch-chinesische Wissenschaftsbeziehungen am Beispiel der Germanistik « (mit Ingo. H. Warnke und Jianhua Zhu)